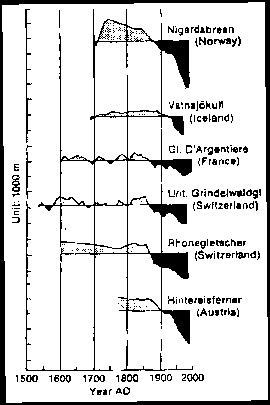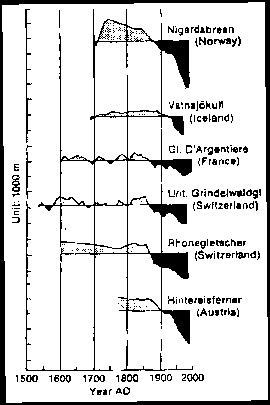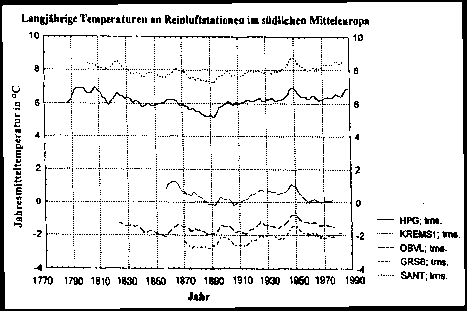Arbeitsgruppe Alpengletscher als Klimaindikator?
Klima und Gletscher
Im Rückblick auf das Klima vergangener Tage zeigt es sich
als zeitlich wie räumlich variabel und Schwankungen unterworfen.
Ausdruck dessen sind z.B: Überlieferungen von praktiziertem
Weinanbau in Schottland (12. Jahrhundert), von Gletschervorstößen
in Argentiere (Frankreich) vor 1850 und Zufrieren der Themse Ende des
16. Jahrhunderts.
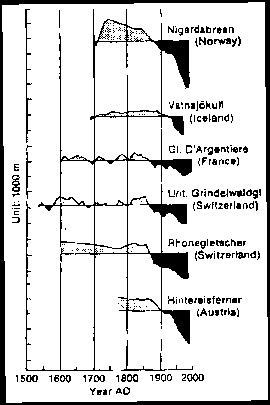
Die Zeitreihen repräsentativer Stationen zeigen einen
Anstieg der Jahresmitteltemperaturen um 0.5 Kelvin in den letzten 140
Jahren. Die Gletscher reagierten mit einem Anstieg der
Gleichgewichtslinie. Im Vergleich zu 1850 beträgt die
vergletscherte Fläche nur noch 25 %. Es liegt nahe, diesen
radikalen Schwund nicht nur der Temperaturveränderung zuzuschreiben
(Umweltverschmutzung). Rechnungen, die nur die Temperatur als Parameter
enthalten, prognostizieren für das Jahr 2030 einen weiteren Flächenverlust
der österreichischen Gletscher von 90 %; der schweizer Gletscher
von 75 %. Die bereits erwähnten kleinen Gletscher der
Goldberggruppe werden selbst bei gleichbleibender Jahresmitteltemperatur
in 30 Jahren abgeschmolzen sein. Große Gletscher reagieren
allerdings ausgesprochen träge auf veränderte Klimaverhältnisse.
Bei letzteren sind neben der Temperatur die Feuchte, die Bewölkung
und zusätzlich die Gletscheralbedo zu beachten. Den größten
Einfluß auf die Massenbilanz üben Winterniederschlag und
Sommertemperatur als auch sommerlicher Niederschlag in Form von Schnee
aus (Sommeralbedo).
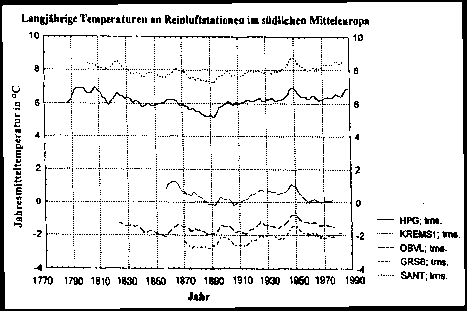
Schlußfolgerungen:
- Die angesprochenen Änderungen der Vergletscherung im Alpenraum
sind für das Weltklima nicht relevant. Für die Regionen
ergeben sich Probleme (Wasserkreislauf, Energieversorgung, Tourismus).
- Die Einflußgrößen Temperatur, Feuchte, Bewölkung
und Albedo sind nicht unabhängig voneinander; eine Modellierung
ist auch wegen des Charakters der Größen erschwert. Für
die polaren Eisflächen machen solche Modellierungen wegen meßtechnischer
Probleme Sinn.